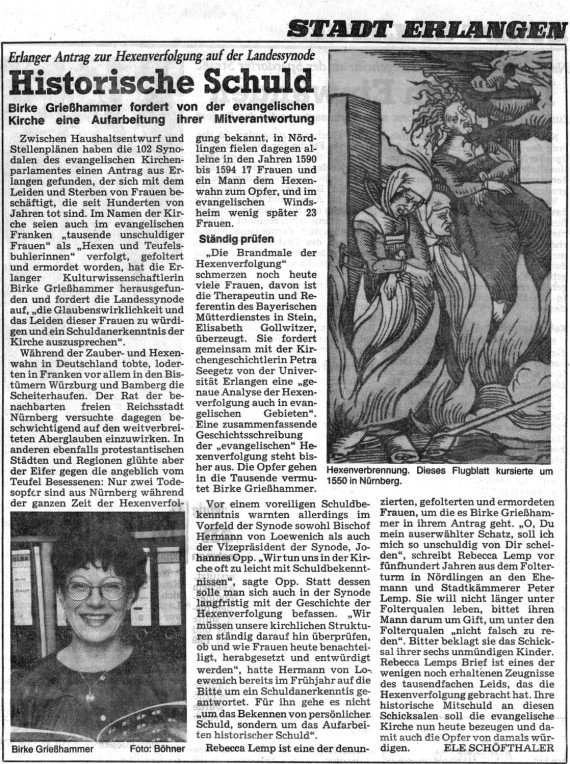Aktuelles
Verschweigen und Verharmlosen:
Die Erzbischöfe Frankens und ihr Umgang mit der Hexenverfolgung
1. Am Anfang stand die Frauenbewegung
Als ich Mitte der achtziger Jahre begann, mich für die Hexenverfolgung zu interessieren, lagen kaum zuverlässige Forschungen für Franken vor. Das Internet gab es noch nicht. Die Bücher von Riezler (1896), Soldan-Heppe (3. Aufl. 1911) und Friedrich Merzbacher (1970), sowie einige Veröffentlichungen als Beilagen in örtlichen Zeitungen vermittelten die Grundkenntnisse zu diesem Thema. Aber das war zu wenig. Lange Zeit schwiegen die örtlichen Historiker zu diesem ungeliebten Thema. Man hätte wohl gerne weiterhin den Mantel des Schweigens über das „abergläubische Verhalten der Vorfahren“ gedeckt.
Angeregt durch die Frauenbewegung mit der Frage von Erika Wisselinck: Hexen, warum wir so wenig von ihrer Geschichte erfahren und was davon auch noch falsch ist [1] machte ich mich auf die Suche
und die Erforschung der Prozessakten.
Erika Wisselinck suchte einen Grund für diese „grandiose Verdrängung“ und dafür, dass das ganze Thema unter dem Stichwort „unverständlicher Wahn einer genauen Betrachtung entzogen wird“.
Ihre Interviews u. a. mit dem Geschichtsprofessor Johannes Kunisch [2] und ihre Analyse einschlägiger Handbücher und Geschichtsdarstellungen verdeutlichten die herrschende Auffassung, dass die
Hexenverfolgung einem abergläubigen Wahn geschuldet gewesen sei, der lediglich eine „Randgruppe“ betraf, die keinen „Eigenwert“ habe und daher im Sinne der Strukturgeschichte unwichtig sei. Er betraf
ja lediglich Frauen. „Keiner hat Schuld […] niemand ist für diese Greuel verantwortlich zu machen, es gab keine Täter. Letztlich war es der Geist jener Zeit“. Das meinte der Herr Professor
1985/6.
Inzwischen hat sich doch Einiges geändert, wenn auch leider noch zu wenig.
Am 27.8.2012 hat der katholische Erzbischof von Bamberg Ludwig Schick eine Art Bedauern zu den Hexenopfern geäußert [3] Dieses geschah auf Druck des Kultursenates der Stadt Bamberg. Schick erklärte
die „Urteile gegen Hexen im Hochstift Bamberg für null und nichtig.“ Er sagte: “Wir aber können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was wir aus ihr lernen können, müssen
wir aber für die bessere Zukunft annehmen.“ Dazu meinte er, in der allgemein gehaltenen Vergebungsbitte im Rahmen des 1000 jährigen Jubiläums des Hochstifts sei der „Hexenwahn im Hochstift
Bamberg“ bereits enthalten gewesen.
Dennoch: Es war ein weiter Weg bis zu dieser lauen Aussage des Erzbischofs Schick. Er bedauerte auf Druck der Öffentlichkeit, der Medien und weil „sein“ Kirchenvolk massiv und nachhaltig eine
kirchliche Stellungnahme zu den unschuldig Hingemordeten verlangt hatte.
Mehrfach hatte der evangelische Pfarrer Hartmut Hegeler aus Unna eine moralische Rehabilitation der Opfer verlangt und sein Bittgang zum Oberbürgermeister der Stadt Bamberg und zum Erzbischof Schick
war in der Presse und sogar im bayerischen Fernsehen (BR 3) gezeigt worden. Außerdem hatte Ralph Kloos aus Bamberg als Privatperson versucht in der Nähe des ehemaligen Trudenhaus ein Museum als Ort
des Gedenkens für Hexenopfer mitten in der Stadt ein zu errichten. Zwar war dies gescheitert, aber die Ämter der Stadt waren nun endlich aufgeschreckt. Einige Heimatforscher wurden eilig zu einer
Vortragswoche gebeten, die im Grunde wenig Neues sagten. Die schlimmen Ereignisse in Bamberg waren nicht länger zu verschweigen.
Noch ist das Bekenntnis einer Mitschuld der katholischen Bischöfe an der Hexenverfolgung, wie es die evangelische Landessynode in Bayern bereits vor Jahren aussprach, nicht erfolgt.
Die Verlautbarung des Erzbischof Ludwig Schick vom 6.10.2012 und die Erinnerung an seine Reue von 11. März 2007 befriedigt uns nicht.
Bisher fand Erzbischof Schick von Bamberg:
- kein Wort des Mitleidens oder Trostes für die Opfer und ihre Angehörigen,
- kein Wort zur Teufelslehre,
- kein Wort zur Missachtung des Weibes.
Es ist noch viel zu tun!
2. Die grausamen Massenhinrichtungen der Hexen in Franken
Sie wurden bereits vor mehr als 13 Jahren auch in Bamberg einer größeren Öffentlichkeit bekannt. In seinem Stadtarchiv wurde unter der Leitung von Dr. Zink die Wanderausstellung Hexenverfolgung in Franken mit 98 Tafeln und einem Begleitbuch vom 23.2. bis zum 26.3.1999 gezeigt. Sie war erweitert mit Originalen aus dem Stadtarchiv. Es kamen in den vier Wochen über 2000 BesucherInnen, es wurden 200 Kataloge verkauft und es wurden ca. 25 Schulklassen von Frau Dr. Urban geführt.
Spätestens seitdem war auch in Bamberg dieses grauenhafte Unrecht bekannt, aber die Verantwortlichen in Stadt, Universität und Kirche reagierten nicht und schwiegen weiterhin.
Weiterhin beharrten die Staats treuen Archivare, die Kirchenoberen und die Historiker in Bayern – vornehmlich CSU-Beamte – darauf, die Hexenhinrichtungen seien lediglich den weltlichen Richtern zur
Last zu legen, nicht aber den Kirchen. Der Klerus habe mit diesem ganzen Thema überhaupt nichts zu tun gehabt. Alles sei ein „wellenartig“ über die Menschheit gekommener Aberglaube gewesen, dem sich
niemand hätte entziehen können.
1997 hatte die Synode der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern auf meinen Antrag hin halbherzig eine „Schuldanerkennung“, kein Schuldbekenntnis wie beantragt an den Hexenverfolgungen ausgesprochen [4].
Die umfangreiche Landesausstellung vom Haus der bayerischen Geschichte 1998 in Ingolstadt „Zur Geschichte der Frauen in Bayern. Von der Völkerwanderung bis heute“ verschwieg die
Hexenverfolgung weitgehend. Sie wurde einfach übergangen. Aus Platzgründen – wie es hieß. Offenbar hatte das Fehlen niemand bemängelt. In dem ausführlichen Katalog [5] wurden die Hexenopfer
nicht erwähnt.
Die Forschungsergebnisse aller inzwischen zahlreich veranstalteten Landesausstellungen [6]führten in Bayern zu keiner Revision der gebetsmühlenartig wiederholten Irrtümer und zu keiner eigenen
Landesausstellung zu diesem Thema.
Der angesehene katholische Kirchenhistoriker in Bayern Walter Brandmüller [7], der an den Universitäten Augsburg und Dillingen [8] lehrte, verbreitet bis heute unwidersprochen
Irrlehren zur Hexenverfolgung. In Bayern gibt es seit 1924 noch 21 Konkordatslehrstühle für Philosophie, Geschichte, Erziehungswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften, deren Inhaber der
katholischen Kirche angehören und ihr genehm sein müssen.
Erst neulich wurde eine Klage gegen diese Ungleichbehandlung vom Verwaltungsgericht Ansbach abgewiesen [9]. So kann in Bayern Geschichtsklitterung weiterhin von höchster Stelle gelehrt werden.
Prof. Brandmüller stellte in einer Mitschrift seiner Vorlesung an der Uni Augsburg [10] fest, die Hexe kennzeichne „einen Abfall vom Glauben an Gott“, also Ketzerei. Sie habe „übermenschliche
Kräfte“ und sie habe sich „dem Satan ausgeliefert. […] Überdies teilt Luther den Glauben an die Hexen“ und in Wittenberg seien vier Personen zu seinen Lebzeiten als ‚Hexer’ verbrannt worden. Die
Angeklagten seien auch „von irgendwie auffälligem Aussehen“ gewesen.
Zur Schuldfrage behauptet der Herr Professor und Kardinal die historische Wahrheit verdrehend Papst Innozenz VIII. habe im 15. Jahrhundert keine „Hexenbulle“ erlassen, sondern lediglich die beiden
Verfasser des Hexenhammers Spengler und Institoris dabei unterstützt gegen Hexen zu predigen und den Hexenhammer in Mainz, Köln, Trier und anderswo zu verbreiten. Das sei aber kein Gebot des Papstes
gewesen, sondern lediglich eine „Empfehlung“, also ein „Reskript“ und habe keine große Bedeutung. Erstaunlich, dass ein an Universitäten promovierter und lehrender Professor unwidersprochen von
Kollegen solche Verdrehungen verbreiten darf.
Wie die Beiträge im Internet zeigen wird dies vom gläubigen Kirchenvolk auch geglaubt, denn Brandmüller ist dort eine Autorität. Er wurde inzwischen zum Kardinal erhoben und seine
Geschichtsdarstellung steht in der Kirchenzeitung „Gloria“ zu lesen.
In besagter Bulle oder im sogenannten Reskript „Summis desiderantes“ (aus dem Lateinischen übersetzt) heißt es: In großer Sorge die „Irrtümer gänzlich auszurotten“ […] gebieten wir, dass es „erlaubt
sey“ in denen „Meynzischen, Cölnischen, Trierischen, Salzburgischen Ertzbistümern und Städten und Ländern, Orten und Bistümern“, wo „sehr viele Personen beyderlei Geschlechts, die ihrer eigenen
Seeligkeit vergessend vom Catholischen Glauben abgefallen sind“ und sich mit „denen Teufeln als Männer oder Weiber mit ihnen vermischen, Missbrauch machen […] das Amt der Inquisitoren zu verrichten
und nicht zu verzögern sie „in Hafft“ zu nehmen, an Leib und an Vermögen zu straffen“. Solches soll mit denen geschehen, die andere mit […] „sowohl innerlichen als eben äußerlichen Schmerzen und
Plagen belegen und peinigen […] und die Frauen, dass sie nicht empfangen“ [11] […] all denen, die solches „Ketzerische Unwesen treiben“ […] soll bei Ungehorsam „der Zorn des allmächtigen Gottes
und Seiner Heiligen Apostel Petri und Pauli“ treffen. Gegeben zu Rom St. Peter 5. Dezember 1484, Papst Innozenz VIII [12].
Der Erzbischof von Mainz herrschte im 17. und 18. Jahrhundert auch über zahlreiche Gebiete um Würzburg herum. Die Bistümer Würzburg und Bamberg wurden zeitweise von dem gleichen Fürstbischof regiert.
So wirkte die Papstbulle unverzüglich weiter nach Franken. Der Papst wünschte sich – wie es in der Bulle heißt – dass der Glaube vermehrt werde und alle „ketzerische Bosheit aus den Grenzen der
Gläubigen vertrieben werde“. Die systematische Hexenverfolgung in diesen streng katholischen Gebieten ist unleugbar. Dagegen behauptet der Herr Kardinal weiterhin unangefochten, die „eifrigsten
Hexenverfolger seien nicht die Priester, sondern die weltlichen Juristen“ gewesen.
Brandmüller meint: „Zusammengefasst war der Hexenwahn eine Erscheinung der nördlichen Länder Europas, England ausgenommen. In den katholischen Kernlanden Italien, Spanien, sowie in großen Teilen Frankreichs spielte Hexenverfolgung praktisch keine Rolle. […] Protestantisch gewordene Länder […] und das nördliche Deutschland zählen zu den Brennpunkten der Hexenverfolgung. […] Dazu zählte auch das katholische Franken, das Rheinland und Südwestdeutschland. […] Die Bischöfe haben sich […] vom Zeitgeist mitreißen lassen“. In England hatte die Königin Elisabeth jegliche Hexenprozesse verboten. Es fanden keine statt! Das war also möglich.
Fazit: die Hexenverfolgung eskalierte in protestantischen Ländern, d. h. doch wohl dort, wo die katholische Kirche versuchte, Glaubensabtrünnige zurückzugewinnen. Also war die Hexenverfolgung u. a.
ein Mittel der Gegenreformation, um verlorene Schäflein einzufangen oder auszurotten.
3. Eine halbherzige Verlautbarung des Bischof Schick: die Prozesse seien „null und nichtig“
- Wen hat der Erzbischof in Sachen Hexenprozesse im Jahr 2007 eigentlich um Vergebung gebeten? Meinte er die Opfer oder Gott selber?
- Was wollte wohl Ludwig Schick mit seiner Presseerklärung bewirken, in der er die Hexenverbrennungen in Bamberg „Unrecht“ nennt. Eine Würdigung der Opfer oder/und ihre Rehabilitierung hat nicht statt gefunden.
- Ist Ludwig Schick im Jahr 2012 berechtigt, die Ketzerurteile seiner Vorfahren im Amte für „null und nichtig“ zu erklären? Alle Hexen sind bis heute päpstlicherseits nicht absolviert, denn sie wurden im Jahre 2000 im Bußgebet des Papstes nicht einmal genannt. Nach wie vor gilt, dass sie Teufelshuren waren.
- Was würde es für die katholische Kirche bedeuten, wenn es keine Teufel und keine Hexen gäbe? Dann fiele wohl ein Teil ihres Lehrgebäudes zusammen und Priester dürften braven Katholiken, die keine Kirchensteuer zahlen wollen, ein christliches Begräbnis in geweihter Erde nicht verweigern.
- Haben sich die kirchlichen Würdenträger geirrt, als sie Menschen als Hexen und Hexer verurteilten? Oder können sich katholische Geistliche wegen ihrer Weihe gar nicht irren?
- Sind die verdammten Seelen der als Hexen und Hexer Hingerichteten aufgrund der Schick-Erklärung jetzt erlöst? Sind sie jetzt bei den Seeligen?
- Darf man an geweihten Orten, also auf dem Friedhof und in den Kirchen der Hexenopfer auf Tafeln gedenken und könnten ihre Namen an besonderen Gedenktagen in den Kirchen verlesen werden?
- Werden die in größter Seelennot der Kirche mehr oder minder gezwungen vermachten Stiftungen und die eingezogenen Vermögen den Hilfsbedürftigen gegeben?
4. Eine klare Stellungnahme des Bischofs zu den Massenhinrichtungen in Bamberg
2012 war sie nicht mehr zu umgehen, denn die Unzufriedenheit der Gläubigen nahm gerade in Bayern wegen kirchlicher Missstände vehement zu. Die Bistümer wurden von den Hirten Reinhard Marx München-Freising, Ludwig Schick Bamberg, Walter Mixa Augsburg, Gerhard Ludwig Müller Regensburg, Gregor Maria Hauke Eichstätt und Dr. Friedhelm Hofmann Würzburg geleitet. Besonders Müller, Marx und Mixa waren erzkonservativ. Müller duldete in seiner Diözese „keinerlei Emanzipationsphilosophie“, wie er sich ausdrückte, weshalb dort die Kirchenlaien mehrfach auf der Straße gegen ihn demonstrierten.
Missbrauchsskandale, Schläge und sexuelle Übergriffe an abhängigen Jungen und Mädchen und ein schwacher Aufklärungswille wird bis heute gerade in Bayern der katholischen Kirche vorgeworfen:
Zahlreiche Missbrauchsfälle in kirchlichen Internaten, in Jesuitenschulen, wie dem Canisius-Kolleg [13] und in dem Bamberger Ottonianum, ein katholisches Internat unter dem Rektor Otto
Münkemer [14] – heute ranghoher Domkapitular - konnten nicht länger verschwiegen werden. Der Augsburger Bischof Walter Mixa hatte sich zahlreicher Prügelattacken wehrloser Kinder schuldig
gemacht, die ihm von der Staatsanwaltschaft nachgewiesen worden waren. Einsicht oder Reue zeigte er nicht. Auch in Bamberg hatte sich ein Domkapitular solcher Verbrechen schuldig gemacht. Er wurde
ebenfalls in den Ruhestand strafversetzt [15].
Im April 2012 forderten in Augsburg 3 000 Laien mehr Mitsprache in ihren Kirchengemeinden. Ein katholischer Kirchenchrist, der auf der Straße gegen seinen Bischof demonstriert, das ist eine
erstmalige Sensation! Überall brodelt es unter dem katholischen Kirchenvolk. Dennoch versucht der Vorsitzende der Bischofskonferenz Robert Zollitsch bis heute alle Reformbestrebungen zu negieren oder
zu unterbinden. Trotz alledem wird der Papst mit riesigen Steuergeldern bei Besuchen – in Freiburg mit 3 Mio. – und Geburtstagen geehrt und geschützt. Doch das Einkommen der Bistümer schrumpft. Im
Erzbistum Bamberg verließen 2011 bereits 3 362 Gläubige ihre allein selig machende Kirche, im Jahr davor waren es 5 800.
Im Bistum Eichstätt waren es 1 772, davor doppelt so viele, bayernweit waren es im Jahr 2011insgesamt 34 376, im Jahr davor ca. 60 000. In Bayern wohnen noch 6,76 Mio. Katholiken und 2,6 Mio. Protestanten [16].
5. Wir fordern von der katholischen Kirche
Wir fordern von der katholischen Kirche ein ehrliches Schuldbekenntnis und eine Würdigung der verzweifelten und von den christlichen Priestern und Pfarrern in größter Sterbensangst verlassenen Hexenopfer.
Wir erbitten ein Schuldbekenntnis zu den Hexenopfern, das von der gesamten Bischofskonferenz öffentlich ausgesprochen wird.
Wir erbitten ein ehrendes Gedenken an einem besonderen Sonntag im Kirchenjahr an die unschuldigen Hexenopfer in allen Kirchen.
Wir fordern die Rückführung der bekannten widerrechtlich eingezogenen Vermögen und Anwesen der Opfer an die Bürgerschaft.
Wir fordern eine Revision der theologischen Teufelslehre aller christlichen Konfessionen, des Judentums und des Islam. Teufel, Hölle, Hexen, Satan, Teufelspakt, gefallene Engel, Fegefeuer, ewige Qualen, ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis, ohne Absolution zu sterben, nicht in „geweihter Erde“ ruhen zu dürfen … alles dieses, was Christen als für ihr Seelenheil unabdingbar gelernt haben, müsste endlich von den Kirchenlehrern revidiert werden.
Erst dann wären auch die Schreie und die Gebete der Gequälten erhört und ihnen ihre Würde zurückgegeben...
...und ihre Seelen könnten Ruhe finden.
Birke Grießhammer
20.12.2012
gr.birke@arcor.de
Quellen:
[1] Verlag Frauenoffensive, Erstauflage 1986, München
[2] Universität Köln zu seinem Artikel im Großen Ploetz
[3] NN 28.8.2012, 3.9.2012 und www.domradio.de/news/artikel_836339.html vom 6.10.2012
[4] www.anton-praetorius.de/arbeitskreis/kirchliche-stellungnahme.htm. Die evangelischen Nachfolger im Am schwiegen wiederum zu diesem einmalig mutigen Schritt
[5] Herausgegeben von Agnete von Specht mit einem Grußwort des Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, 400 Seiten, mit 17 Beirätinnen, sowie mit Beiträgen von 81 Autoren und Autorinnen
[6] Saarland, Schwäbisch Hall, Karlsruhe, Berlin, Hamburg, Speyer, Schmalkalden usw..
[7] Walter Brandmüller, geb. 1929 in Ansbach, Chefhistoriker der Kurie, Präsident des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft, Bundesverdienstkreuz, promovierte in München über die
Rekatholisierung im evangelischen Markgrafentum Ansbach-Bayreuth, Priester in der Erzdiözese Bamberg
[8] Diese katholische Uni wurde zur Zeit der Reformation von Karl V. als Ersatz für die evangelisch gewordene in Augsburg gegründet und 1563 den Jesuiten übergeben
[9] NN 29.7.2011
[10] http://de.gloria.tv/?media=104838 vom 17. Mai 1996
[11] Offenbar kannte man damals Verhütungsmittel, die die Kirche nicht akzeptierte, was von einigen Uni-Historikern immer wieder geleugnet wird
[12] Zitiert nach: Egbert Friedrich, Hexenjagd im Raum Rodach und die Hexenprozessordnung von Herzog Johann Casimir, Rodach bei Coburg, 1995, 159-161
[13] An dem Jesuitengymnasium deckten der Jesuit Pater Klaus Mertes und der ehemalige Schüler Matthias Katsch mutig die Kindsmisshandlungen der Vergangenheit auf. www.eckiger-tisch.de
[14] Der Tagesspiegel, deutsch, 14.8.2008
[15] NN 1.5.2012, der Name wurde verschwiegen.
[16] www.dbk.de
Rückblick 1985 - 2003:
Die Schuldanerkennung der Evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns 1996
Vom Antrag zum Synodalbeschluß
Als engagierte Christin stellte ich bereits im Juni 1994 an den Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Hermann von Loewenich, den Antrag, sich für ein Schuldbekenntnis der Synode der evangelischen Landeskirche in Bayern in Sachen Hexenverfolgung in Franken vom 16. bis 18. Jahrhundert einzusetzen. In einem längeren persönlichen Schreiben wurde dies abgelehnt, da die Kirche heute mit den Tätern von gestern nichts mehr zu tun habe.
Daraufhin wiederholte ich meinen Antrag in einem Schreiben an den Präsidenten der Synode, Dr. Dieter Haack. Ich bat darum, in dieser Sache „eine Schuldanerkennung auszusprechen und die Glaubenswirklichkeit und das Leiden der Frauen zu würdigen“. Sie wurden als Hexen hingerichtet, „weil ihnen ihr Frau-Sein als Schuld (Erbsünde und Sündenfall Evas) und ihre Geschlechtlichkeit als Unzucht und Teufelsbuhlschaft zur Last gelegt wurde. Sie starben in großer Verzweiflung und Isolation … Dies geschah nicht in der Nachfolge Jesu Christi … Wir bitten darum, auch unserer Schwestern zu gedenken, auf deren Wurzeln wir fußen und von deren Glaubenskraft wir heute gerne zehren würden. Zumindest eine Schuldanerkenntnis der kirchlichen Stellen sollte ausgesprochen werden. Dazu ist weiterhin eine Aufklärung und Veröffentlichung ihrer Leiden bzw. des Verhaltens der Kirche in der angegebenen Zeit in Franken dringend notwendig.“ [1]
Daraufhin wurde unter der Leitung des Theologie-Professor Joachim Track eine Arbeitsgruppe gegründet, die ein Heft zu den Ereignissen und den theologischen Lehren des 16. und 17. Jahrhunderts
zusammenstellte. Dieses Heft und die vorbereitete Erklärung wurden dann von der Synode lediglich zur Kenntnis genommen.
Folgende Pressemitteilung wurde am 29. November 1996 veröffentlicht:
Bayerische Synode: Auch Kirchen haben sich an Hexenverfolgungen beteiligt - Schuldanerkenntnis abgelegt
Von Jörg Schneider (epd)
Freising: Mit dem Leiden und Sterben von Frauen, die bereits seit mehreren hundert Jahren tot sind, hat sich die bayerische Landessynode beschäftigt. Seit 1994 liegt dem
evangelischen Kirchenparlament ein Antrag der Erlanger Kulturwissenschaftlerin Birke Grießhammer zum Thema Hexenverfolgung vor, in dem eine öffentliche „Schuldanerkenntnis” der Landeskirche gefordert
wird.
Im Namen der Kirche seien auch im evangelischen Franken „Tausende unschuldiger Frauen” als “Hexen und Teufelsbuhlerinnen” verfolgt, gefoltert und ermordet worden, so Grießhammer.
Am Donnerstag legte die bayerische Kirche eine Schuldanerkenntnis ab.
Der systematischen Hexenverfolgung fielen in Europa etwa 100.000 Menschen zum Opfer, meist Frauen (80 Prozent), aber auch Männer und Kinder. Wegen angeblicher Zauberei, böser Beschwörung oder
sexueller Ausschweifungen wurden in der Zeit zwischen 1560 und 1630 allein in Bayern mehr als 5.000 Frauen verbrannt. Nördlingen, Ansbach und Coburg waren Hochburgen der Hexenverfolgung im
protestantischen Bereich.
Mit der öffentlichen Schuldanerkenntnis hat es sich das evangelische Kirchenparlament allerdings nicht leicht gemacht. Nicht nur Landesbischof Hermann von Loewenich, sondern auch der Vizepräsident
der Synode, Johannes Opp, hatten vor voreiligen Schlüssen gewarnt. „Wir tun uns in der Kirche oft zu leicht mit Schuldbekenntnissen”, sagte Opp vor zwei Jahren.
Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Thema Hexenverfolgung eingehend behandeln sollte.
Trotz aller Vorbehalte verabschiedete die Landeskirche nun in Freising ein Schuldanerkenntnis.
„Auch durch die Theologen und die Kirchen der Reformation ist Anstiftung zur Hexenverfolgung, Beteiligung an der Hexenverfolgung und das Geschehenlassen von Hexenverfolgungen erfolgt”, heißt es in einer Stellungnahme, die das Kirchenparlament ohne Gegenstimme „zustimmend zur Kenntnis genommen hat”.
Mit „Schmerz und Trauer” müsse festgestellt werden, dass die Kirchen der Reformation „in der Hexenverfolgung schuldig geworden” seien.
Allerdings liege es nicht im Interesse der Landeskirche, „den Vätern und Müttern Schuld zuzuweisen, um zu richten”.
Vielmehr gehe es um ehrliche und genaue Aufklärung über das schuldhafte Reden und Handeln der Kirche in der Vergangenheit, um für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.
„Wir wollen anerkennen, daß diese Geschichte auch zur Geschichte der Kirche gehört und stehen in gemeinsamer Solidarität in der Schuld”, sagte Professor Joachim Track (Neuendettelsau) vor
den Synodalen.
Die bayerische Landeskirche will aber nicht nur Schuld bekennen, sondern Konsequenzen ziehen. Denn die durch das Thema Hexenverfolgung gewonnenen Einsichten verpflichten die Kirchen und alle
Christen, „ihre Sicht der Frau, des Verhältnisses von Mann und Frau, ihre Sicht von Leiblichkeit und Sexualität zu überprüfen und den Prozeß des Umdenkens zu fördern“.
Die Hexenausstellung im Stadtmuseum Erlangen 1985, eine Pionierarbeit.
Als Leiterin eines kleinen Stadtmuseums in der Hugenottenstadt Erlangen unter der SPD geführten Stadtregierung (OB Hahlweg und Kulturreferent Dr. Schnetz), war es mir wohl erstmals in Franken und in Bayern möglich, das Thema Hexenverfolgung in einer Zeitausstellung in einem seriösen Museum vom 24.3. – 8.9.1985 darzustellen.
Wir leisteten damit Pionierarbeit im Süden der BRD und in Bayern.
Zur Vervollständigung für dieses in diesem Gebiet wenig erforschte Thema entlieh ich die Tafeln der Wanderausstellung aus dem Hamburgischen Museum für Völkerkunde und dem dortigen Hexenarchiv mit dem einschlägigen und reich bebilderten Katalog „Hexen“ der „Arbeitsgruppe Hexen“ [2] von Thomas Hauschild, Heidi Staschen und Regina Troschke. Zu den sehr hohen Ausstellungstafeln, deren Transport von Hamburg nach Erlangen und deren Aufhängung uns herausforderte, erarbeiteten wir in Erlangen etwa 10 eigene Tafeln für Franken. Sie waren, wie es uns die finanziellen Möglichkeiten erlaubten, mit vergrößerten Schreibmaschinentexten und kopierten Abbildungen beklebt [3].
Damals war die Aufarbeitung der Drutenjagd – die Hexen werden in Franken Trutt oder Drut genannt – neu und wurde zuerst von Frauen [4] angeregt. Sie forderten eine angemessenere Beachtung,
Erforschung und Darstellung auch in den Geschichtsbüchern der Schulen [5].
Mein Chef untersagte es mir, bei der Ausstellungseröffnung am 24.3.1985 zu sprechen und akzeptierte nur widerwillig eine andere Historikerin. Er sprach selber und äußerte sich kritisch zur
Forschungsarbeit von Historikerinnen und zur Frauengeschichte.
Die Ausstellung war liebevoll mit einem Kräutergarten aus dem Botanischen Garten Erlangen und mit einem angedeuteten Scheiterhaufen aufgebaut. Die Originale zeitgenössischer Holzschnitte und
Radierungen in Rahmen ergänzten die Texttafeln. Sie waren Leihgaben des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Druckkosten für einen Kataloges wurden nicht genehmigt.
Besucher und Besucherinnen kamen in Scharen. Bei den regelmäßigen Sonntagsführungen konnte ich die Zuhörer dicht gedrängt kaum in dem kleinen Ausstellungssaal bewältigen.
Bereits damals erfuhr ich von Seiten der Historiker Vorbehalte und Skepsis, weil dieses Thema doch überschätzt oder von Frauen nicht angemessen bewertet würde. Man könne der Tendenz dogmatischer
Verallgemeinerung erliegen.
Nach Beendigung der Ausstellung wollte ich die Hexenverfolgung in Franken ausführlich und gründlicher erforschen und gründete die historische Arbeitsgruppe RAUTE [6] mit Wissenschaftlerinnen
verschiedener Fachrichtungen. Sie arbeiteten alle engagiert, aber ehrenamtlich.
Die Bitten um eine finanzielle Unterstützung der Ausstellung wurden abgelehnt, obwohl damals bereits einzelne Frauenprojekte in Nürnberg gefördert wurden. Lediglich der Bezirk Mittelfranken gewährte
einen Zuschuss von 2.000.- EU. Meine Arbeitszeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin für dieses Projekt wurde vom Kulturreferenten der Stadt Erlangen genehmigt.
Am 10.1.1997 wurde die Ausstellung Hexenverfolgung in Nürnberg und in Franken im Stadtarchiv Nürnberg eröffnet [7]. Die über 90 Tafeln, beklebt mit Texten und Bildern waren thematisch bezeichnet
und überschrieben: Erklärungsversuche, Beschuldigungen, Karte Franken mit den Hinrichtungsorten, Besagungen, Prozessverfahren, Liebeszauber, Zauberei und Magie … Der zweite Teil der Ausstellung war
nach Orten gegliedert und zeigte die Vorgänge in den herausragenden Hinrichtungsorten Frankens.
Ein reiches Programm mit dem Gesang der Hexenzeitung als Moritat von Frau Rüppel vorgetragen, mit einem gemalten Triptychon von Carola Singer-Dorndorff und mit Leihgaben aus dem GNM bereicherte die
Ausstellung im Pellerhaus. Die Ausstellungstafeln wurden anschließend bis 2003 in 20 Orten in Franken, in Baden-Württemberg und in Hessen gezeigt.
Die Wanderausstellung „Hexenverfolgung in Franken“ wurde an folgenden Orten gezeigt: [8]
- in fünf Museen (Bad Mergentheim, Ingolstadt, Ellingen, Bad Windsheim),
- in drei Stadtarchiven (Bamberg, Nürnberg, Hofheim/Taunus) und in dem Staatsarchiv Ludwigsburg,
- in der evang. Theologischen Hochschule Neuendettelsau,
- in Würzburg (evang. Kirche und Gleichstellungsstelle),
- in Hemhofen (Evang. Kirchengemeinde und ökumenisches Frauenforum Hemhofen/Röttenbach, Evang. Bildungszentrum Erlangen),
- in der Bildungsstätte der kath. Kirche Kloster Schöntal (Baden-Württemberg),
- in den städtischen Kulturämtern Forchheim und Zeil,
- in Kronach (Kulturreferat des Landratsamtes unter der Leitung von Gisela Lang),
- in Fürth (Historische Gruppe),
- in Königshofen (Gruppe Historisches und kulturelles Königshofen),
- in Herzogenaurach
- in Lichtenfels
An einigen Orten wurde die Ausstellung auf Veranlassung ehrenamtlicher Frauengruppen im kirchlichen und politischen Bereich entliehen. Das war oftmals schwierig, da diese Gruppen keinerlei Kompetenz
hatten und für die Genehmigung bei ihren Stadtherren oder Gemeindepfarrern, für die Miete eines Raumes, für den Transport, für die Hängung, für die Versicherung und für die Aufsicht sorgen mussten.
Auch mussten sie die Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Ankündigungen), ein Begleitprogramm und Führungen durch die Ausstellung bewältigen. Um die notwendigen Mittel dafür mussten sie sich ebenfalls
kümmern.
In Herzogenaurach in der Nähe Erlangens gelegen, entstand eine überparteiliche Frauengruppe (Bündisgrüne Frauen, Frauen-Union, Freie Wählerinnen und SPD-Frauen). Sie ergriff die Initiative,
bewältigte alle Anforderungen und finanzierte mit privaten Spenden die Unkosten. Ähnliches leisteten die Frauen in Lichtenfels (Oberfranken). Sie inszenierten in der Ausstellung ein ehrendes Gedenken
an die Opfer mit Kerzen und farbigen Tüchern. In Lichtenfels und in Herzogenaurach waren die Bürgermeister bei der Eröffnung nicht zugegen So war es auch im Stadtarchiv Bamberg, wo dazu auch die hohe
Geistlichkeit fehlte.
Im Bildungshaus Kloster Schöntal, Hohenlohe, Baden-Württemberg erinnerten die Veranstalterinnen in der Ausstellung an das enttäuschende Bußgebet des Papstes Johannes Paul II. im Jahre 2000, in das er
die als Hexen Verfemten und Hingerichteten nicht einbezog.
Die Museumsleiterinnen in Bad Mergentheim (5 578 BesucherInnen in der Ausstellung) und in Ingolstadt, Frau Dr. Beatrix Schönewald, waren besonders erfolgreich. Sie gestalteten zusammen mit
Künstlerinnen die Ausstellung.
Gedenkgottesdienste an die als Hexen Verfemten feierten Christen und Christinnen beider Kirchen mehrfach miteinander. In Nürnberg veranstaltete eine Frauengruppe unter der Leitung
von Birke Grießhammer in der historisch wichtigen evangelischen St. Lorenzkirche am 14. Oktober1995 eine Feierstunde. Es ging um Erinnerung, Gedenken und Trauer. Die Predigt hielt die Pfarrerin
Andrea Borger. Alle Beiträge in Wort und Ton (Bach – Arien) wurden von Frauen erarbeitet, eingeübt und vorgetragen. Besonderen Wert legten wir auf die Nennung der Namen der Opfer und der Täter. In
Nürnberg befanden sich unter den Richtern und Ratsherren auch solche, deren Geschlechternamen als Stifter und Wohltäter der Lorenzkirche noch heute einen guten Klang haben. Viele scheuten deshalb
davor zurück. Wir taten es dennoch. Niemand beklagte sich. Auch in Würzburg veranstaltete die evangelische Kirchengemeinde St. Johann unter der Leitung von Pfarrerin Strattner am 18.11. 1998 einen
Hexengedenkgottesdienst. An zahlreichen Orten in verschiedenen Bundesländern wurden inzwischen ähnliche Gottesdienste oder Gebete abgehalten.
Inzwischen hat sich eine Initiativgruppe um den evangelischen Pfarrer im Ruhestand, Hartmut Hegeler [9], in Unna (NRW) gebildet, die in Gottesdiensten, auf Kirchentagen, in Vorträgen und im
Internet auf die Hexenopfer in Deutschland aufmerksam macht und bei betroffenen Stadtparlamenten ihre moralische Rehabilitation fordert. Dieses rege Diskussionsforum wurde bisher von den
Universitätsgelehrten gemieden.
In katholischen Kirchenkreisen ist das Thema Hexen, Teufelshuren, Satansbündner immer noch weitgehend tabu, vor allem in den besonders betroffenen Bistümern Bamberg, Würzburg und
Eichstätt. Doch regt sich hier und dort in den emanzipierten Gemeinden Interesse an den Massenhinrichtungen in den fränkischen Fürstbistümern.
Zahlreiche lebende Künstlerinnen und Künstler haben zum Thema Hexen und Hexenverfolgung gearbeitet.
Bedeutende Ausstellungen zum Thema Hexenverfolgung fanden auf Landesebenen zuerst im Saarland (Oskar Lafontaine, Schirmherr), dann in Schwäbisch Hall 1988 und in Karlsruhe 1994,
statt. Umfangreichere Vorhaben, die auch besser finanziert waren, gab es dann in Berlin 2002, im Hamburgischen Museum für Völkerkunde 2001 und zuletzt im Historischen Museum der Pfalz in Speyer,
2009. In diese Darstellungen wurden die WissenschaftlerInnen der Universitäten eingebunden. In Thüringen läuft noch bis zum 15.1.2013 die Ausstellung Luther und die Hexen auf Schloß Wilhelmsburg in
Schmalkalden unter der Leitung des Direktors Dr. Lehmann.
Aber das Hexenthema ist wohl bereits „out“, bevor es noch als wichtiges historisches Ereignis angemessen gewertet in den Schulbüchern verankert wurde.
Franken und Bayern warten immer noch auf eine umfassende Aufarbeitung dieses Themas in einer Landesausstellung.
Birke Grießhammer
Dezember 2012
gr.birke@arcor.de
Quellen:
[1] Schreiben von Birke Grießhammer an den Präsidenten Dr. Dieter Haack am 20.7.1994
[2] Impressum: „material 31“, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Juni 1979
[3] Die Texte verfassten Birke Grießhammer, Beate Franke, Ute Freißler, Michael Peters und Gertrud Lehmann mit Unterstützung bei der Literatursuche von Prof. Dr. Endres,
Erlangen/Bayreuth, der damals auch Mitglied im Beirat des Museums war
[4] Erika Wisselinck, Hexen, warum wir so wenig von ihrer Geschichte erfahren und was davon auch noch falsch ist, Verlag Frauenoffensive, München, 1986
[5] Die Promotionsarbeit von Wolfgang Behringer, die für Bayern grundlegend werden sollte, erschien im Oldenbourg Verlag, München, in 2. Auflage 1988 und war zur Zeit der
Ausstellungserarbeitung vergriffen
[6] Mitarbeiterinnen in der Arbeitsgruppe waren Traudl Kleefeld, Dr. Segets, Gabriele Moritz, Ute Freißler, Susanne Kleinöder, Gisela Lang, Barbara Michler, Sonja Eckert, Katharina Fürst,
Alison Rowlands, die Künstlerin Carola Singer-Dorndorff und Verena Osgyan als Gestalterin der Tafeln
[7] Dr. Helmut Beer ermögliche dies Vorhaben. Sein Chef war bei der Eröffnung nicht anwesend
[8] Birke Grießhammer, Erfahrungen mit der Wanderausstellung „Hexenverfolgung in Franken 16. – 18. Jahrhundert in: Hexen im Museum, Hexen heute, Hexen Weltweit, Hexensymposium 31.10. – 2. 11. 2004, Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, Neue Folge Band 34, Hamburg, 2004, S. 380 - 399
[9] www.anton-praetorius.de